 |

 |
 |
 |
 |
 |
 |
// LinuxTag 2004
Besuchen Sie uns auch nächstes Jahr wieder auf dem LinuxTag 2004
im Karlsruher Messe- und Kongresszentrum. Für nähere Details und den
genauen Termin besuchen Sie bitte die LinuxTag Homepage.
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
EUROPAS GRÖSSTE GNU/LINUX MESSE UND KONFERENZ
KONFERENZ-CD-ROM 2003 |
 |
 |
|
 |
|
|
| Hauptseite // Vorträge // Markenrecht und Open Source - Sinn oder Unsinn? |
 |
 |
Markenrecht und Open Source - Sinn oder Unsinn?
Dipl.-Wirtsch-Inf. Jana False
Autor
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Jana False
E-Mail: jana.false@tu-ilmenau.de
Markenrecht und Open Source - Sinn oder Unsinn?
Die Bedeutung des Markenrechts insbesondere des Markengesetzes (MarkenG) [MG94] als gewerbliches
Schutzrecht nimmt vor allem seit der Entstehung des Internets stetig zu.
Marken-, Firmen-, Domainnamen und Werktitel spielen im Zeitalter von Suchmaschinen und weltweitem
Zugriff auf Informationsquellen im Internet eine immer größre Rolle.
1 Was schützt das Markengesetz?
Nach dem Markengesetz werden folgende Kennzeichen geschützt:
Der Begriff der Marke" wurde 1995 durch das neue Markengesetz eingeführt und hat den bis dahin
geltenden Begriff Warenzeichen" abgelöst. Zudem wurde der Begriff dem internationalen
Sprachgebrauch z. B. Trade Mark, Le Marque, La Marca angenähert.
Als Marke können alle Zeichen geschützt werden, die geeignet sind, Dienstleistungen und Waren
eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Markenschutz kann in
der Regel für Wort-, Bild oder kombinierte Wort-/Bildmarken erlangt werden.
Linux® |
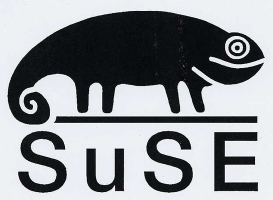
|

|
Wortmarke |
Wort-/Bildmarke |
Bildmarke |
Wesentlich seltener werden dagegen Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich
der Form der Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und
Farbzusammenstellungen geschützt.
Als geschäftliche Bezeichnung werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.
Bei Unternehmenskennzeichen handelt es sich um Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als
Name, Firma, besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden.
Dazu gehören auch sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs verwendete Zeichen, welche
innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten. Werktitel nehmen
hierbei eine gesonderte Stellung ein. Sie können als Name, besondere Bezeichnung von Druckschriften,
Film-, Ton-, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichenbaren Werken wie z. B. in Form von Softwaretiteln
bzw. Softwarenamen geschützt werden.
2 Wie entsteht Markenschutz?
Schutzrechte an einer Marke können auf drei Wegen erworben werden:
- durch Anmeldung und Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom
Patent- und Markenamt geführte Register, - durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das
Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrgeltung erworben
hat, oder - durch die notorische Bekanntheit einer Marke. Der Schutz einer Marke erstreckt sich grundsätzlich auf bestimmte Waren und Dienstleistungen.
Bei der Anmeldung und Eintragung eines Zeichens als Marke wird das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen vom Markenanmelder vorgegeben. Bei nicht eingetragenen Marken, die benutzt werden
und Verkehrsgeltung erlangt haben, sind es diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die die
Marke als Kennzeichen im Geschäftsverkehr entsprechend bekannt ist.
Ausgeschlossen von der Eintragung in das Markenregister sind im wesentlichen solche
Zeichen, die
- nicht graphisch darstellbar sind, - nicht unterscheidungskräftig sind, - im Geschäftsverkehr freizuhalten sind - Staatswappen, Staatsflaggen oder staatliche Hoheitszeichen enthalten - gegen die öffentliche Ordnung verstoßen - täuschenden Charakter haben. In der Praxis kommt der Frage der Unterscheidungskraft und der Prüfung, ob ein Freihaltungsbedürfnis
vorliegt, die größte Bedeutung zu. Hierbei muß die Marke immer mit Blick auf die angegebenen Waren
und Dienstleistungen beurteilt werden.
Nicht unterscheidungskräftige Zeichen sind solche, die von den Verkehrskreisen lediglich als eine
beschreibende Bezeichnung für eine Ware oder Dienstleistung verstanden werden. Solche Angaben können
die Herkunftsfunktion einer Marke, d. h. deren Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, nicht erfüllen.
So sind beispielsweise extra, mini, plus und ideal für alle Waren und Dienstleistungen sowie
Illustrator für ein Zeichenprogramm schutzunfähig. Unterscheidungskräftig sind hingegen Marken, die
einen beschreibenden Inhalt haben, wenn dieser Inhalt zur Ware oder Dienstleistung ohne Bezug ist.
Das Wort "phyton" wäre z. B. für Computerprogramme schutzfähig, nicht jedoch für Produkte einer
Schlangenfarm.
Nicht schutzfähig sind zudem solche Angaben, an deren freier Verwendung ein berechtigtes Interesse
der Allgemeinheit oder der Mitbewerber besteht. Dies gilt insbesondere für alle Fachangaben, die z. B.
zur Beschreibung der Art, der Beschaffenheit, des Ortes der Herstellung, der Zweckbestimmung und des
Preises der Waren und Dienstleistungen dienen. Die Wortkombinationen "Open Source Software" und
"Public License" wären dementsprechend für Computerprogramme nicht schutzfähig. Dagegen wären
"Red Hat Open Source Software","Mozilla Public License","GNU General Public License" nicht
freihaltebedürftig und somit schutzfähig.
3 Wie wird eine Marke angemeldet?
Jeder, der ein Schutzrecht an einem Zeichen erwerben will, kann seine Marke selbst oder mit Hilfe
eines auf diesem Gebiet erfahrenen Rechts- bzw. Patentanwaltes anmelden [MB02]. Dies setzt einen Antrag
in der Regel auf einem formgebundenen Formular [MA02] voraus, der bestimmte Angaben enthalten muß:
Anmelder einer Marke können eine oder mehrere natürliche Personen, juristische Personen
oder Personengesellschaften (sofern sie Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen können)
sein. Die Anmelderdaten, in der Regel der Name und die Adresse, müssen es erlauben, die Identität des
Anmelders festzustellen.
Die exakte Wiedergabe der Marke ist besonders wichtig, da die Darstellung im Antrag für die
Eintragung im Register und spätere Veröffentlichung maßgebend ist. Im Antrag ist zudem die Form
der Marke z. B. Wortmarke oder Bildmarke anzugeben.
Dem Anmeldeantrag ist weiterhin ein Verzeichnis beizufügen, das die Waren und Dienstleistungen
enthält, für die die Eintragung der Marke beantragt wird. Maßgebend für die Abfassung des Verzeichnisses
ist die amtliche Klasseneinteilung [KL02]. Insgesamt gibt es 45 Waren- und Dienstleistungsklassen.
Für eine Marke aus dem Open Source Bereich könnte das Verzeichnis zum Beispiel wie folgt aussehen:
Klasse 9
Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-,
Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente
zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur
Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten;
Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen,
Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.
Klasse 16
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten.
Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier und
Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und
Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke.
Klasse 42
Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche
Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und
Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung.
Mit der Anmeldung sind Gebühren [MA02] an das Deutsche Patent- und Markenamt zu zahlen. Sie setzen
sich aus einer Anmeldegebühr und aus Klassengebühren zusammen. Die Anmeldegebühr beträgt 300 € und
ist eine Pauschalgebühr. Sie umfaßt die Kosten für die Eintragung in das Markenregister, für die
Veröffentlichung der eingetragenen Marke sowie für drei Klassen die Klassengebühr. Ab der vierten in
Anspruch genommenen Klasse ist für jede Klasse eine Klassengebühr in Höhe von 100 € zusätzlich
zu entrichten. Der einfachste und sicherste Weg, die Gebühren zu bezahlen, ist die formulargebundene
einmalige Einzugsermächtigung [EZ02].
Die ausgefüllten Anmeldeformulare sind im Original an das Deutsche Patent- und Markenamt,
- Markenabteilungen -, 81534 München zu schicken. Ist die vollständige Anmeldung beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, wird ein Aktenzeichen vergeben. Es wird festgestellt,
in welche Klassen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen fallen und anschließend unverzüglich
eine Empfangsbescheinigung mit einer Gebührenbenachrichtigung versandt.
4 Welche Schutzdauer und Rechtswirkungen haben eingetragene Marken?
Die Schutzdauer beginnt mit dem Anmeldetag und endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den
der Anmeldetag fällt. Sie kann unbeschränkt um jeweils 10 Jahre verlängert werden. Eine Verwirkung
von Ansprüchen kann dadurch eintreten, daß der Zeichenrechtsinhaber die Zeichen fünf Jahre nicht
benutzt hat oder wissentlich die rechtswidrige Benutzung der Marke über einen Zeitraum von fünf
Jahren duldet.
Eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke ist im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland geschützt, aber nicht im Ausland. Ein allein kraft Verkehrsgeltung geschütztes Zeichen
genießt dagegen nur in dem Raum Schutz, in welchem die Verkehrsgeltung nachgewiesen werden kann. Dies
kann beispielsweise ein Bundesland oder auch nur der örtliche Einzugsbereich eines Unternehmens sein.
Eintragung oder Verkehrsgeltung der Marke geben dem Inhaber ein ausschließliches Benutzungsrecht
und damit einhergehend ein Verbietungsrecht gegen andere. Allein dem Markeninhaber steht das Recht zu,
die geschützte Marke für die betroffenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen. So kann er Waren und
Dienstleistungen unter dem Zeichen vertreiben, die Verpackung, Umhüllung oder Aufmachung mit der Marke
versehen oder die Marke bei Ankündigungen, in der Werbung, in Preislisten und für Geschäftspapiere
benutzen. Zudem ist dem Markeninhaber das Versehen der eingetragenen Marke mit dem
Registrierhinweis "®" und eine Lizenzvergabe vorbehalten.
Dritten ist jede Benutzung eines kollidierenden Zeichens, d. h. eines identischen oder
verwechslungsfähigen Zeichens, für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen im geschäftlichen
Verkehr untersagt. Benutzt ein Dritter widerrechtlich das geschützte Zeichen, können Schadensersatz und
Unterlassungsansprüche erhoben werden. Zudem bestehen Auskunfts- und Vernichtungsansprüche für
widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände sowie die Vorrichtungen zu deren Herstellung bzw. Benutzung.
Weiter hat der Markeninhaber ein Widerspruchsrecht gegenüber jüngeren, verwechslungsfähigen Zeichen,
die beim Patentamt zur Eintragung angemeldet werden.
5 Wie sollte ein Namen oder ein Logo gewählt werden?
Die Komplexität und die Vielfahlt der Ausgangssituationen von Open Source Projekten machen es
schwierig, eine einzige, universelle Strategie zu finden, die in jedem Fall anwendbar ist, um einen
Namen oder ein Logo zu kreieren. Dennoch ist es möglich grundlegende Prinzipien zu benennen, die sich
in den meisten Findungsprozessen umsetzen lassen. Ein Name bzw. ein Logo
- muß auffallen, - muß sich abgrenzen und eine eigene Sphäre besetzen, - soll sich nicht an bekannte Marken anlehnen und keine Modewörter
enthalten, - soll eher suggerieren und andeuten als beschreiben, - soll in allen Ziel- bzw. Sprach-/Kulturgebieten funktionieren und keine
Mißverständnisse bzw. Mißdeutungen hervorrufen, - soll sich auch in schwarz/weiß darstellen bzw. kopieren lassen und - muß juristisch einwandfrei sein. Nachdem ein Zeichen geschaffen wurde, sollte eine Recherche nach einer möglichen
Markenrechtsverletzung durchgeführt werden, da Zeichenrechte Dritter verletzt werden könnten.
Dies ist vor allem deshalb zu empfehlen, weil das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Anmeldung
einer Marke nicht prüft, ob bereits ähnliche oder identische Marken registriert sind.
6 Wie wird eine Markenrecherche durchgeführt?
Zuerst sollte recherchiert werden, ob dem Namen eingetragene Marken entgegenstehen. Für ein
Kennzeichen, das in Deutschland benutzt werden soll, müßten dazu die Deutsche Marken,
EU-Gemeinschaftsmarken und IR-Marken (International Registrierte Marken) mit Schutz in
Deutschland überprüft werden. Die entsprechende Recherche nach identischen Wortmarken bzw.
den identischen Wortmarkenanteilen bei Wort-/Bildmarken kann in diesen Online-Datenbanken erfolgen:
Keine der kostenfreien Online-Datenbanken bietet die Möglichkeiten einer Ähnlichkeitsrecheche
an. Um die Ähnlichkeitsrecherche dennoch in Ansätzen durchführen zu können, kann versucht werden,
diese mit Hilfe von Wildcards, logischen Operatoren oder durch wiederholte Suchanfragen mit
entsprechend verschiedenen Wortschöpfungen durchzuführen.
Steht dem Namen kein Markenschutz von eingetragenen Marken entgegen, muß überprüft werden, ob
Schutzrechte, die durch die Benutzung im geschäftlichen Verkehr erworben wurden, oder von notorisch
bekannten Marken berührt werden. Dazu sollten insbesondere die geschäftlichen Bezeichnungen wie
Firmen- und Domainnamen sowie die Titel von Werken z. B. in folgenden Datenbanken überprüft werden:
Logos können vom Laien nicht in Markendatenbanken oder im Internet recherchiert werden. Einen
ersten Ansatz bietet lediglich die Suchmaschine Google mit der Option Bildersuche.
Die eigene Recherche kann die professionelle Markenrecherche in kostenpflichtigen Datenbanken
im Internet, auf CD-ROMs oder in Printmedien und das Gespräch mit einem erfahrenen Recht- bzw.
Patentanwalt nicht ersetzen. Sie kann jedoch die Sicherheit, nicht gegen Markenschutzrechte Dritter
zu verstoßen, enorm erhöhen. Immerhin garantiert auch eine Markenrecherche eines erfahrenen
Rechercheurs keinen absoluten Schutz vor Markenrechtsansprüchen. Zudem stößt man häufig schon
bei eigener Recherche auf mögliche Markenrechtsansprüche, die ein Überdenken der Namenswahl
nahe legen.
8 Was ist bei einer Abmahnung wegen der Verletzung von Markenrechten zu beachten?
Mit der zunehmenden Bekanntheit und Verbreitung von Open Source Software wächst auch die
Gefahr einer Abmahnung wegen der Verletzung von Markenrechten. Bei Open Source Projekten führen
diesbezüglich vor allem folgende Punkte zu Problemen
- die bewußte Anlehnung an bekannte Marken bzw. Namen und Logos, - keine Überprüfung älterer Rechte, - Übernahme von Projektverantwortung ohne die rechtlichen Konsequenzen zu
bedenken, - Vermischung von kommerziellen und freien Entwicklungsprojekten. Erhält man eine Abmahnung wegen der Verletzung von Markenrechten, sollte man mit einer
Markenrecherche zuerst einmal überprüfen, ob die angegebenen Kennzeichenrechte überhaupt bestehen
und der Anspruch berechtigt ist. Oft sind die benannten Ansprüche unbegründet. Die Abmahner
spekulieren dabei auf die organisatorische Schwäche kleinerer Open Source Projekte, die sich meist
nur unzureichend gegen die juristischen Angriffe wehren können und dann den Forderungen, obwohl
dies nicht nötig wäre, nachgeben.
Bei der Frage, ob die Ansprüche berechtigt sind, muß zusätzlich abgeklärt werden, ob das abgemahnte
Open Source Projekt im geschäftlichen Verkehr tätig ist. Dies ist dann der Fall, wenn es kommerziell
tätig ist oder im direkten Wettbewerb zu anderen kommerziell tätigen Unternehmen steht. Meist reicht
schon die Schaltung von Werbung z. B. über ein Banner, um im Sinne des Markenrechts im geschäftlichen
Verkehr tätig zu sein. Handelt es sich bei dem Open Source Projekt indes um ein Forschungsprojekt an
einer Universität, bei dem ausschließlich die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung vorangetrieben
werden soll, ist das Projekt nicht im geschäftlichen Verkehr tätig kann somit überhaupt nicht
gegen Markenrechte verstoßen, da diese nur im geschäftlichen Verkehr geltend gemacht werden können.
Handelt man nicht im geschäftlichen Verkehr oder sind die Ansprüche aus sonstigen Gründen nicht
berechtigt, sollte man dies dem Abmahner unter ausführlicher Darlegung der Gründe schriftlich mitteilen.
Lag der Abmahnung eine strafbewehrte Unterlassungserklärung und eine Rechnung über die entsprechenden
Anwaltsgebühren bei, sollte in dem Schreiben darauf hingewiesen werden, daß man keine Veranlassung
sieht, die Unterlassungserklärung abzugeben und die Rechnung zu bezahlen, da man offensichtlich
nicht gegen die Markenrechte des Abmahners verstößt. In der Regel meldet sich der Abmahner dann
nicht wieder. In Ausnahmefällen wird er aber dennoch versuchen, seine vermeindlichen Rechte auf dem
Gerichtsweg durchzusetzen. Hier muß dann jedes Open Source Projekt für sich entscheiden, ob die
Beibehaltung des Kennzeichens die Kosten und Mühen wert ist.
Besitzt dagegen der Abmahner die älteren Markenrechte, muß seinen Forderungen im gesetzlichen
Rahmen nachgekommen werden. Die betreffenen Marken müssen sofort entfernt werden und dürfen zukünftig
nicht mehr benutzt werden. Lag der Abmahnung eine strafbewehrte Unterlassungserklärung mit der
Androhung einer Vertragsstrage bei nicht Befolgung bei, muß diese unterschrieben und zurückgesandt
werden. Auf der Unterlassungserklärung sollte ergänzt werden, daß die Erklärung ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht gleichwohl rechtsverbindlich und unter der auflösenden Bedingung einer auf Gesetz
oder höchstrichterlichen Beurteilung der zu unterlassenden Handlung als rechtmäßig abgeben wird.
Lag der Abmahnung zudem eine Rechnung über die entsprechenden Anwaltsgebühren bei, sollte diese
nicht bezahlt werden. Dem Abmahner sollte diesbezüglich mitgeteilt werden, daß es keiner anwaltlichen
Hilfe bedurft hätte, um auf die Markenrechtsverletzung hinzuweisen, und man daher nicht bereit ist,
dafür die Kosten zu übernehmen. Sollten die Anwälte des Abmahners auf die Bezahlung der Rechnung
bestehen, sollte man versuchen sich auf die Zahlung einer niedrigeren Gebühr zu einigen oder als
Endlösung die verlangte Gebühr bezahlen, da Anwälte im Markenrecht bereits für das erste Schreiben
eine Gebühr entsprechend der Gebührenordnung verlangen können.
9 Können bekannte Open Source Namen und Logos frei benutzt werden?
Das Markenrecht gilt auch für alle Namen und Logos von Open Source Projekten bzw. Software, d. h.
auch diese sind nicht generell frei nutzbar, sonder nur im rechtlichen und eingeräumten Rahmen. Ein
Blick in die rechtlichen Hinweise, Lizenzbestimmungen oder die FAQs wird in der Regel Aufschluß darüber
geben.
Für die Zope-Logos findet sich z. B. eine eigene Seite Zope Logo Usage [ZM03], auf der detailliert
darauf eingegangen wird, wofür das Logo frei benutzt werden kann. Meist sind die Hinweise zur Benutzung
der Marken in den Open Source Lizenzen enthalten. Zum Teil finden sich dort aber auch ausdrückliche
Verbote der Benutzung von Marken. So sieht die Apple Public Source License (APSL) in § 10 [AL99] einen
ausdrücklichen Vorbehalt aller von Apple gehaltenen Marken vor. Wer also Software entsprechend den
Vorschriften von APSL verbreitet, darf hierbei die Marken Apple , QuickTime usw. nicht benutzen.
Von besonderem Interesse für die Open Source Community ist die Verwendung der Marke Linux und
des Tux-Pinguins. Linux ist aus dem Vornamen seines ursprünglichen Entwicklers Linus Torvalds
abgeleitet, der auch Inhaber der Markenrechte ist. Die Benutzung der Wortmarke ist somit von der
Einwilligung Linus Torvalds, der damit das Linux Mark Institute [LL00] beauftragt hat, abhängig.
Privatpersonen bzw. End-User können die Marke Linux mit dem Hinweis ® frei benutzten.
Gleiches gilt für Linux-Bücher, Produktbeschreibungen, technische Reports und den Hinweis, daß die eigene
Software unter Linux läuft. Sollen hingegen eigene Produkte oder Dienstleistungen mit der Marke "Linux"
versehen werden, kann das zeitlich unbefristete Nutzungsrecht an der Marke nur gegen eine einmalige
Zahlung einer Lizenzgebühr erworben werden. Handelt es sich bei den Produkten und Dienstleistungen
um Hard- oder Software, beläuft sich die Lizenzgebühr auf 500 US$ ansonsten auf 250 US$. Für ein
Linux-basiertes Betriebssystem mit dem Namen "TU Ilmenau Linux" wären demnach 500 US$ und für den
Namen eines Schulungsunternehmens mit dem Namen "Linux Akademie Deutschland" 250 US$ als Lizenzgebühr
zu zahlen.
"Tux" ist der Name für einen Pinguin, der 1996 von dem Graphiker Larry Ewing [TX96] auf Wunsch
von Linus Torvalds gezeichnet wurde. Bislang wurde keine Bildmarke eingetragen, die Tux als Bildzeichen
verwendet. Mittlerweile gilt für das Tux-Bild jedoch auch ohne Eintragung Markenschutz, da die
Verwendung des Tux- Bildes als Bezeichnung für GNU/Linux und für Dienstleistungen rund um GNU/Linux
üblich ist und somit Verkehrgeltung erlangt hat. Die Urheberrechte und damit einhergehend auch die
Markenrechte werden von Larry Ewing frei lizenziert.
10 Ist das Markenrecht für Open Source Projekte sinnvoll?
Die Frage, ob Markenrecht für Open Source Projekte Sinn oder Unsinn ist, muß jeder für sich
selbst beantworten. Außer Frage steht jedoch, daß kein Open Source Projekt darum herum kommen wird,
sich irgendwann mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Spätestens bei der Registrierung einer Domain
sollte über Markenrechte nachgedacht werden, da man sich gemäß der Vergaberichtlinien der
DENIC e. G. [DN00] dazu verpflichtet, daß man keine Markenrechte verletzt.
|
 |
|
