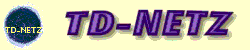
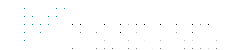
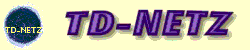
|
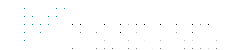
|
Geologie Schleswig-Holstein
|
|
Meerumschlungen, wie es im Schleswig-Holstein-Lied hei▀t, wΣre das Land, wenn in den Eiszeiten nicht Unmassen von Steinen und Ger÷ll aus dem skandinavischen Raum hertransportiert und auf dem voreiszeitlichen Grund abgelagert worden wΣren. Eine vereinigte, rauhe Nord- und Ostsee wⁿrde etwas mehr als ein Dutzend Inseln umbranden, die bekann-testen sind der Kalkberg von Bad Segeberg, der rote Sandsteinfelsen von Helgoland oder das Morsumkliff auf Sylt. Diese "herausragenden" Zeugen sind Relikte aus Perioden vor etwa 270 Millionen Jahren bis 65 Millionen Jahren und wirken wie Fremdk÷rper im Landschaftsbild, das zum gr÷▀ten Teil von den letzten beiden Eiszeiten geformt wurde. Sie begannen vor etwa 200.000 Jahren und endeten vor 13.000 Jahren. Damit ist Schleswig-Holstein geologisch eine der jⁿngsten Landschaften in Deutschland. Warum die Eiszeiten kamen, das ist nicht eindeutig geklΣrt, wie sie jedoch kamen, das lΣ▀t sich heute nachvollziehen. Durch einen durchschnittlichen Temperaturrⁿckgang von nur 5-7░ C kam es ⁿber der ganzen Nordhalbkugel zu verstΣrkten SchneefΣllen, die sich unter ihrem Eigengewicht zu Gletschereis verdichteten. Diese Gletscher bedeckten dann, anders als die Talgletscher, die wir aus den Bergen kennen, ganz Skandinavien als ein Eisschild bis zu 3000 Meter MΣchtigkeit. Auf jedem Quadratmeter lastete dort ein Druck von 2.700 Tonnen. Die gesamte skandinavische Halbinsel wurde durch das Eisgewicht um mehr als 300 Meter abgesenkt und taucht nach der Befreiung vom Eis langsam wieder auf. Diese Bewegung hΣlt bis heute an: in Schweden wurden noch in 330 m H÷he Strandlinien gefunden. Durch den hohen Druck wurde das Eis plastisch und begann zu flie▀en. Alles was im Wege lag, Steinbl÷cke, Schutt, Sand, Lehm, wurde mitgerissen, ganze Berge wurden eingeebnet und TΣler ausgehobelt. Vor oder unter dem Gletscher hergeschoben, in ihm eingefroren oder auf ihm liegend wurde das Material verfrachtet und nach Transportwegen bis zu 1.500 Kilometer in unserer Region abgelagert. Das Eis tⁿrmte sich selbst in den Randgebieten, ⁿber dem heutigen Schleswig-Holstein, immer noch 300 bis 500 Meter hoch auf. Die Eiszungen entwickelten eine unvorstellbare Schubkraft und schⁿrften wie gewaltige Planierraupen tiefe Becken aus, die F÷rden der Ostseekⁿste. Auch im Binnenland haben sich noch einige dieser ehemaligen GletschertΣler erhalten, beispielsweise der Wittensee oder die Seen um Pl÷n und Ratzeburg. Beim Abschmelzen wurde das mitgefⁿhrte Material am Rand des Inlandeises als MorΣnen wieder abgelagert. Die Importe aus Skandinavien findet der aufmerksame Beobachter ⁿber-all in Norddeutschland: das bunte Pflaster auf Stra▀en und PlΣtzen, die Hofeinfriedungen aus gerundeten Feldsteinen, die Kirchenfundamente aus gewaltigen Findlingsbl÷cken. Selbst die typisch norddeutsche Ziegelstein-Bauweise hat mit den Eiszeiten zu tun. Die Steine sind gebrannt aus Ton, Lehm und Mergel, das ist nichts anderes als Gesteinsmehl aus Material, das beim Transport fein zerrieben wurde. In der zweitletzten, der Saale-Eiszeit, drang das Eis fast bis zu den Mittelgebirgen vor und bedeckte selbst einen gro▀en Teil der Nordsee. Sie hinterlie▀ eine AltmorΣne, den charakteristischen flachkuppigen H÷henrⁿcken, der das Land etwa in der Mitte von Nord nach Sⁿd durchzieht, die Hohe Geest. Davor, in westlicher Richtung, breiten sich Schmelzwasser-Ebenen aus, wo das Land so aussieht, wie man sich den Norden ⁿblicherweise vorstellt: brettflach, grⁿn und von WasserlΣufen durchzogen. Die Marsch, die fast ein viertel des Landes einnimmt, liegt kaum ⁿber dem Meeresspiegel, an manchen Stellen sogar darunter. Sie mu▀ durch aufwendige Deichbauten geschⁿtzt werden. Die ÷stlichen Landesteile werden von der letzten, der Weichsel-Eiszeit geprΣgt, die eine kuppige JungmorΣnenlandschaft hinterlie▀, welche die AltmorΣnen zum Teil ⁿberdeckt. Sie erreicht beachtliche H÷hen (Hⁿttener Berge bei Rendsburg: bis 106 m). Die MorΣnen erkennt man an einem Durcheinander von gro▀en Bl÷cken, mittleren und kleinen Steinen bis zu Feinmaterial. Wer solch steinreiches Land besa▀, besa▀ Baumaterial und konnte steinreich werden. Auch die B÷den sind durch ihren Kalkgehalt recht ertragreich. Unter dem Eis entstanden durch Druck und Gewicht des Eises sowie durch herabstr÷men des Tauwasser aus Gletscherspalten rei▀ende Flⁿsse mit starker Str÷mung und beachtlicher Transportkraft. Diese TunneltΣler finden sich in der heutigen Landschaft reliktisch als langgestreckte Seen oder ganze Seenketten wie der Bordesholmer und der Einfelder See, der Flemhuder See, der Langsee in Angeln oder im Lauenburgischen der Schmalsee, Lⁿttauer See und Drⁿsensee. Solche und auch anders entstandene Seen bilden heute die beliebte Urlaubslandschaft der holsteinischen Schweiz. Wo diese Str÷me aus den Gletschern austraten, bildeten sich fΣcherf÷rmige Ablagerungen aus Sand oder Kies etwa einheitlicher Korngr÷▀e, die Sander. Man erkennt sie in Sand- oder Kiesgruben selbst aus der Entfernung an der gleichmΣ▀igen Schichtung, Verbreitet liegen sie vor der Kante der Hohen Geest, aber auch an vielen Stellen im Binnenland, wo Gletscherzungen endeten. Es sind relativ leichte, nΣhrstoffarme B÷den, die fⁿr die Landwirtschaft nicht viel hergeben. Aus ihnen wurde an vielen Stellen Feinsand ausgeblasen und zu Binnendⁿnen aufgeweht. Das verbliebene Schmelzwasser trug ein ⁿbriges zur Formung der Landschaft bei. Es sammelte sich in UrstromtΣlern, deren gewaltige Ausma▀e man sich heute kaum mehr vorstellen kann. Eines davon ist das Elbetal. Man mu▀ es sich 20 bis 30 km breit vorstellen. Ein weiteres Stromsystem ist heute ein unscheinbares Flⁿ▀chen, das bei Neumⁿnster entspringt und nach Norden, Richtung Kieler F÷rde flie▀t. Drei Kilometer vor der Ostsee vermag die Eider nicht die dortige EndmorΣne zu durchdringen und wendet sich nach Westen. Sie mΣandriert fast 80 km durch das breite ehemalige Urstromtal, das der Elbe zuflo▀ und mⁿndet in die Nordsee. Bis in die siebziger Jahre, bevor das Eidersperrwerk fertiggestellt war, drang das Wasser bei Sturmfluten oftmals tief in das Land ein und verwandelte es in einen riesigen, breiten See, der ahnen lie▀, wie es zu den Eiszeiten ausgesehen haben mag. Noch etwa um 900 n.Chr., also zu Wikingerzeiten, war das heutige Wattenmeer festes Land. Ein Marsch- und Moorland zwar, das regelmΣ▀ig ⁿberflutet wurde, aber man konnte eine geschlossene Kⁿstenlinie von Sylt bis Eiderstedt annehmen. Sⁿdlich davon, wo heute kilometerweit landeinwΣrts StΣdte wie Wesselburen und Marne liegen, dⁿrfte die Nordseekⁿste verlaufen sein. Die letzte gro▀e VerΣnderung kam im Mittelalter. Bei einer verheerenden Flut, der "groten ManndrΣnke" von 1362 verloren an die hunderttausend Menschen ihr Leben, und aus dem Land zwischen den Nordfriesischen Inseln und dem Festland wurde wieder Meeresboden. Schleswig-Holstein hat seitdem in Grundzⁿgen seine heutige Form behalten. Einige der Inseln (Sylt, Amrum, F÷hr) und die Halligen sind noch die letzten Zeugen der Besiedlung. Durch Brandung, Wellenschlag, An- und Abspⁿlung werden jedoch stΣndig die Kⁿsten verΣndert. Die Steilufer an der Ostseekⁿste br÷ckeln Jahr fⁿr Jahr bis zu einen halben Meter ab, StrΣnde werden versetzt, selbst ganze Inselteile sind gefΣhrdet, wie der alljΣhrliche Kampf der Sylter um ihre Heimat zeigt. Durch Sperrma▀nahmen, Eindeichungen und K÷ge wurde und wird noch Land hinzugewonnen. Ohne den immensen finanziellen und technischen Aufwand, den die Bewohner zum Kⁿstenschutz betreiben wΣre es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis das Meer sich weite Teile des Landes zurⁿckholen wⁿrde. Wenn sich die Prognosen bewahrheiten, die eine Klima-ErwΣrmung und einen Anstieg des Meeresspiegels voraussagen, dann k÷nnte es fⁿr ein drittel des Landes hei▀en, "Schleswig-Holstein meerverschlungen". [uj] |